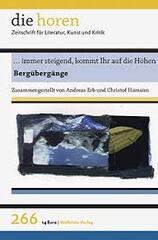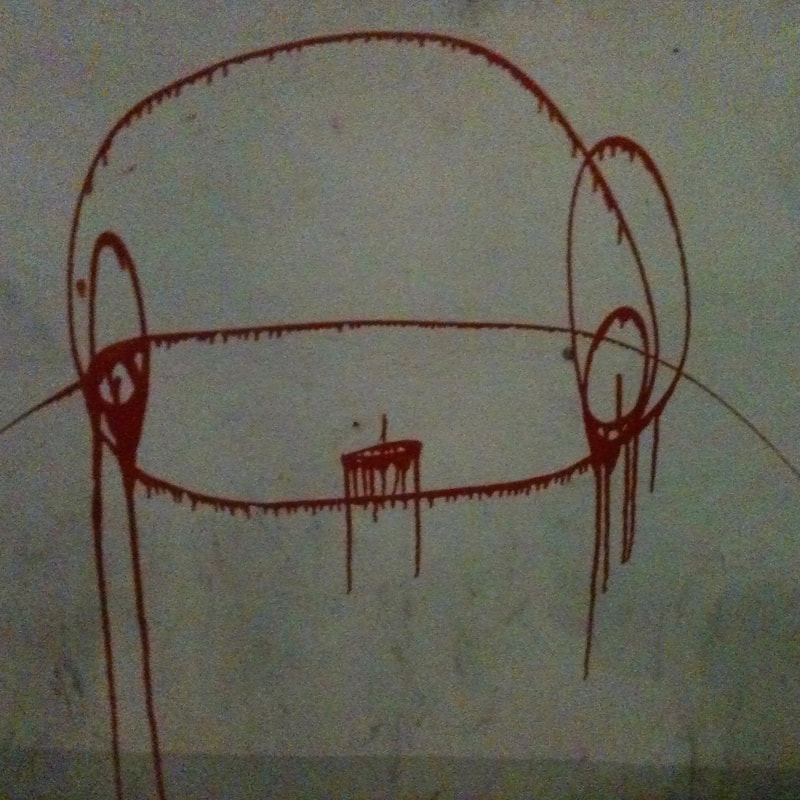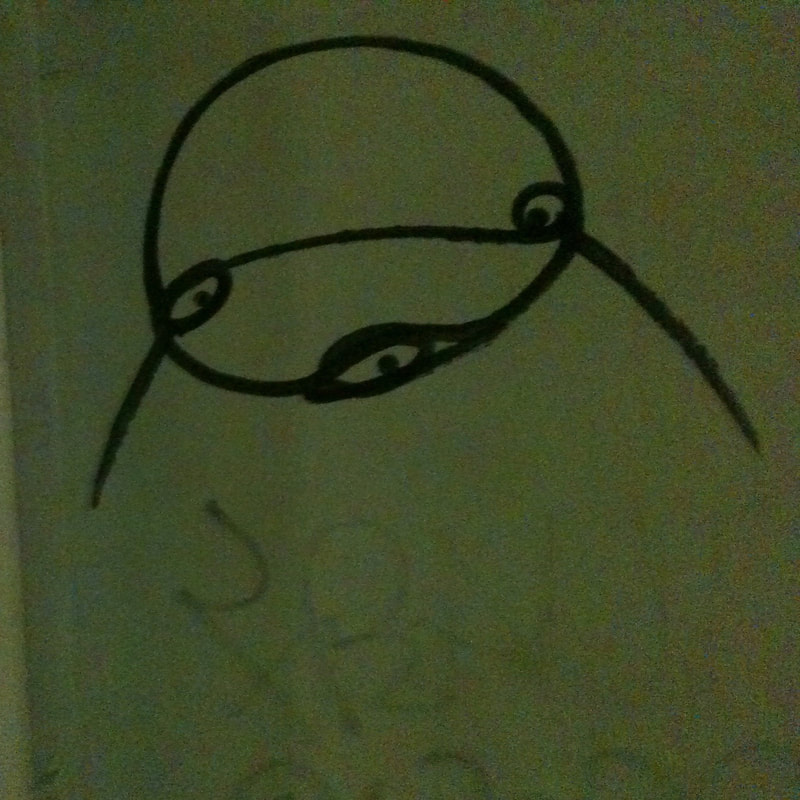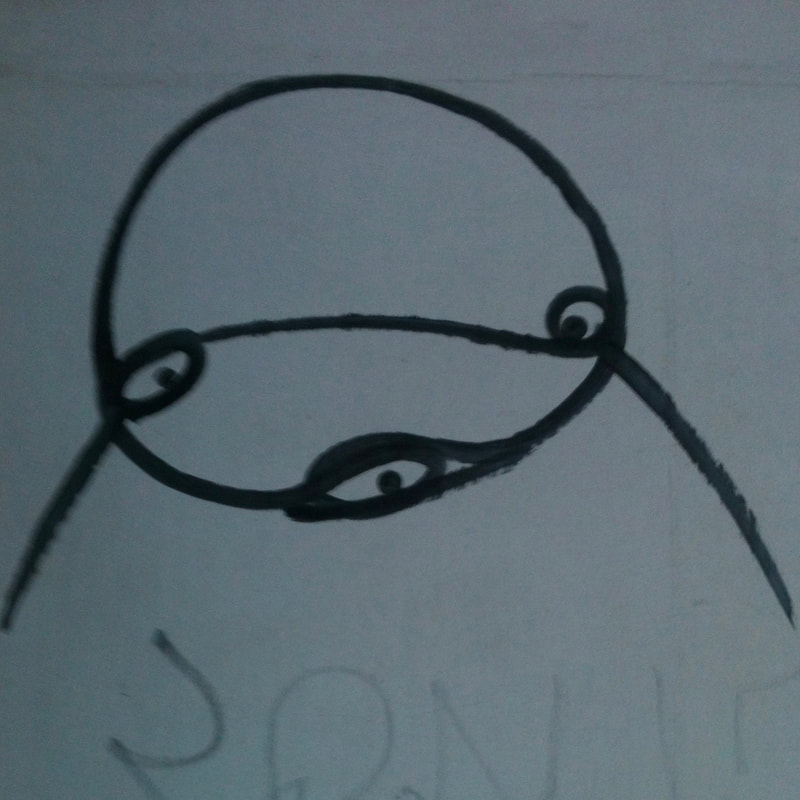TULPEN FRESSENAls ich sie wiedersah, glaubte ich noch immer nicht, dass mein Leben vorbei sein könnte. Eines Tages. Bald. Ich muss früh alt werden, um das ganze Leben zu bekommen, sagte sie, steckte die Finger wie eine Gabel unter die silbernen Strähnen und zog sie vor ihre Augen, prüfend, ob sie in einer Anwandlung von Eigensinn zu ihrem Schwarzbraun zurückgek ehrt wären. Sie hatte noch immer dasselbe Kasperlgesicht mit der kleinen runden Nase und den dicken Lippen, und beim Lachen stellten sich die Brauen im Winkel auf, bildeten ein Zelt über den geschlitzten Augen.
Das war lange nach unserem ersten Sommer, dem Sommer in der Bleecker Street, als wir Tabak und anderes aus dem Fenster rauchten, den Passanten auf die Köpfe spuckten und gegen Mitternacht dem schwarzen Mann, der in einem Kartonverschlag acht Stockwerke unter uns am Rand des Grundstücks wohnte, seine drei Flaschen Bier brachten. God bless you, girls. Das hält uns gesund, sagten wir, und rannten durch den Regen in den Blumenladen am Eck, trugen bunte Sträuße nach Hause, kosteten die Blüten schon im Gehen, roh und ungewaschen. Nachdem wir Rosen, Hortensien, Wicken, selbst Gerbera versucht hatten, verfielen wir auf Tulpen. Es war der Sommer, als wir Tulpen fraßen. Die bitteren roten, die fauligen lilafarbenen, die modrigen orangegelb geflammten Blätter. Zuerst bereiteten wir sie als Salat zu, was ihnen trotz Cayennepfeffer nicht die Fäulnis, nicht die Modrigkeit und auch nicht die Bitterkeit nahm. Dann kochten wir sie in Salzwasser und schlürften die matschigen Fäden, zusammen mit Haarnudeln vom Teller. Wir hassten beide Fettgebackenes, schwenkten sie dennoch in Olivenöl, Koriander und Knoblauch und wischten sie mit Brotkanten auf. Sie schmeckten nach nichts, doch gaben sie uns ein Gefühl der Unverwundbarkeit. Das war der Sommer, als wir noch gesund waren. Gestärkt spritzten wir über die Bowery und fielen in die Sportbar an der Ecke 1st Avenue 1st Street ein, wo wir die Eishockey Playoffs sahen und uns mit ein paar Fans der Pittsburgh Pinguins anlegten. Luzia brachte mir noch einen Jameson und klar, die Tampa Lightnings verloren, aus irgendeinem Grund waren wir immer auf der Seite der Verlierer. Aber gut. Die Pinguine bemerkten, dass wir Mädchen waren, und ließen Drinks kommen, die wir gerne nahmen, und auch zu einem Freund von ihnen, der angeblich ein Loft in der Orchard Street, nicht weit von hier hatte, wollten wir mit, doch vorher mussten sie noch schnell, und verschwanden treppab, verloren in der Schlange vor dem Klo oder auf dem Spiegelchen über der Schüssel wohl den Faden, kamen vollgekokst zurück, und hatten auf einmal ein Riesenproblem mit ihren Turnschuhen. Wir verstanden nicht alles, zirkelten uns von der Bank und gingen Arm in Arm hinaus auf die regennasse Straße. Luzia warf ihr dunkles Haar zurück und schielte über unsere Schulter. Sie kommen nach und presste ihre Clownslippen auf meine. Alles war gut. Zuhause schlangen wir uns ineinander und schliefen, zwei warme Tiere, bis zum Mittag. Luzia holte einen Tulpenstrauß, es waren gelbe, die wir über die Cerealien flockten, unter die Milch tunkten und mit sehr viel Zucker sehr schnell aßen. Wir rauchten und spuckten aus dem Fenster und trafen die kleinen behaarten Kugeln mit wachsender Übung und Kenntnis der Zugluft, die um die Häuser strich. Den Hudson entlang stadtabwärts rannten wir und liebten unsre Muskeln, wie sie nach zweistündigem Lauf schmerzten und uns sagten, wir sind alle da. Und Schweißrinnsale eilten zwischen den Brüsten hinab und über den Bauch. Die Tulpen sind nicht schuld daran gewesen, dass wir uns nun in einem Wartezimmer wiederfinden. Dem Ort, wo Frauen sitzen, wenn sie nach dem Tastritual Erbsen, Haselnüsse oder Aprikosen in ihren Brüsten gefunden haben, Raumforderungen eben. Ich war gekommen, um Kleinteile aus Gewebe und Blut abzuliefern, während Luzia mit ihrem Silberwasserfall aus Haaren längst Stammkundin war, hier ließ sie sich die Leberflecken absuchen, dort die Zuckerwerte einstellen, da die entzündeten Gelenke durchleuchten und in der Uniklinik die Schmerzen der Immunkrankheit behandeln. Ich bin ein Monument der Medizingeschichte, sagte sie und tätschelte eine Einkaufstasche voller Medikamentenschachteln neben sich. Morgens saß sie mit den Blistern da und zählte runde weiße, ovale rote, eckige bläuliche und längliche weiße Kapseln, Tabletten und Pillen in die Fächer der Siebentageplastikbox. Guckst du noch Eishockey? Sie lachte und verneinte. Vom Chinesen erhielt sie zerstoßene Käfer und Wurzeln, ein Pulver, gelborange wie unsere Tulpenblätter. Wir hätten sie kandieren sollen, sage ich, in Zucker wenden, bis sie steif und gläsern sind und knistern zwischen den Zähnen, wie das Eis unter den Kufen der Schlittschuhe. Nie fragten wir uns, ob sie giftig sind, den ganzen langen Sommer nicht, krank wurden wir auch so. Ich gab meine Brüste hin und Luzia, glaubt man der Statistik, die Hälfte ihrer Lebenszeit. Lang vor ihr lieg ich da im Tannenkleid, eine zerstückelte Schaufensterpuppe, und warte auf das Nichts, während kandierte Tulpenblätter auf mich klickern und schwarze Blütenstempel mir die Augen schließen. 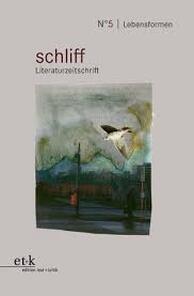
in: Schuchmann, Kathrin, Christopher Quadt: schliff No 5, Lebensformen, Literaturzeitschrift, München: Edition Text und Kritik, 2016. ISSN 2510-4403.
| |||||||
| Beate Rothmaier Herzigkeitsfaktor | |
| File Size: | 1524 kb |
| File Type: | |
BATTAGLIA
Fassade. Von außen kommen, von fernher kommen, den Weg nicht wissen, Sucherin sein. Nähertreten, den Blick heben, Fassaden strotzen eselfarben wie Steppensand, Deisterstein, der sich bei Hitze rötet, wie Thaler jetzt erklärt, dabei die Hände schweben, die weißlichen Finger tanzen lässt im grauen Sommertag, aus dem es sprühregnet auf die vier Gestalten herab. Ein Wind kommt auf, er greift dem Ahorn mächtig ins Gebälk und rennt an gegen diese Wand aus glatt gehauenen Quadern, so Stein auf Stein gefügt, so fein gefügt, so ohne Risse, unverletzt; jetzt tritt er vor, der tourist guide, streicht sich den Schurrbart glatt, tentakelt mit den Fingerchen im Ungefähren dieses achtzehnten Jahrhunderts und verknotet sie, das Hosenbein hebend mit den Schnürsenkeln der kaffeebraunen Lederschuhe, da habe ich mich schon verliebt und spähe vestohlen nach den andern beiden, einem hagern Herrn mit Humpelfuß und einer Stiftsfrau, schwarze Spitze um das Hutzelbirnengesicht. Der Ahorn schüttelt sich. Wir treten in Geschichte ein.
Moose. Moose sammelte die Freundin. 40erlei kratzte sie aus dem Schnee, trug sie in ihr kaltes Schlafgemach, stellte sie in Eisschälchen ums Bett, das schrieb sie mir, der Geliebten; ich aber wollte sie nicht haben, nicht bei mir haben, da in meinem Stift. Ich stand allein am Fenster, russte mit verkohlten Korken mir die Augenbrauen schwarz, schlug die Atlanten auf, bestieg das Wüstenschiff und reiste um die Welt. Die Freundin aber saß, den Winter lang auf einem Turm, mit heimlich gelöstem Haar, das ließ sie flattern im Wind. Mein Bett im kalten Land umblühen Haine schrieb sie; und ich antwortete sofort: hier blühen Moose an den Wänden und modernd duftet Feuchtes in den Mauern dieses Stifts. Vier Fremde stehn im Dunklen, Kühlen, nur Thalers Finger glimmen als er in die Klosterstille spricht, Geheimgang, Kreuzgang, Innenhof uns zeigt und nun mit lässiger Gebärde den Stockrosen gebietet, die gelben Köpfe aufzutun, die Blütenblätter zu spreizen wie Olympiaturnerinnen die bestrumpften Beine; auf der erstarrten Hand trug sie den Hain ins kalte Eisbeetland, setzte die buschigen Büschel in Erdschalen und diese rund ums Bett; Moos ruf ich dem Fremdenführer zu, und dieser, nicht bereitwillig, doch pflichtbewusst, greift danach, weiß achtzehnhundert unter ihnen, weiß alle Laub- und Lebermoose, verliert sich in deren komplizierten Fortpflanzungsgepflogenheiten, bis Herr Hager neben mir den Gummipfropf des Gehstocks auf den Boden klopfen lässt und Dame Hutzel sich die Enden ihres Spitzenschleiers auf den Rücken schüttelt, Zöpfen gleich. (…)
Moose. Moose sammelte die Freundin. 40erlei kratzte sie aus dem Schnee, trug sie in ihr kaltes Schlafgemach, stellte sie in Eisschälchen ums Bett, das schrieb sie mir, der Geliebten; ich aber wollte sie nicht haben, nicht bei mir haben, da in meinem Stift. Ich stand allein am Fenster, russte mit verkohlten Korken mir die Augenbrauen schwarz, schlug die Atlanten auf, bestieg das Wüstenschiff und reiste um die Welt. Die Freundin aber saß, den Winter lang auf einem Turm, mit heimlich gelöstem Haar, das ließ sie flattern im Wind. Mein Bett im kalten Land umblühen Haine schrieb sie; und ich antwortete sofort: hier blühen Moose an den Wänden und modernd duftet Feuchtes in den Mauern dieses Stifts. Vier Fremde stehn im Dunklen, Kühlen, nur Thalers Finger glimmen als er in die Klosterstille spricht, Geheimgang, Kreuzgang, Innenhof uns zeigt und nun mit lässiger Gebärde den Stockrosen gebietet, die gelben Köpfe aufzutun, die Blütenblätter zu spreizen wie Olympiaturnerinnen die bestrumpften Beine; auf der erstarrten Hand trug sie den Hain ins kalte Eisbeetland, setzte die buschigen Büschel in Erdschalen und diese rund ums Bett; Moos ruf ich dem Fremdenführer zu, und dieser, nicht bereitwillig, doch pflichtbewusst, greift danach, weiß achtzehnhundert unter ihnen, weiß alle Laub- und Lebermoose, verliert sich in deren komplizierten Fortpflanzungsgepflogenheiten, bis Herr Hager neben mir den Gummipfropf des Gehstocks auf den Boden klopfen lässt und Dame Hutzel sich die Enden ihres Spitzenschleiers auf den Rücken schüttelt, Zöpfen gleich. (…)

in: Poesie und Stille. Schriftstellerinnen schreiben in Klöstern.
Göttingen: Wallstein Verlag, 2009.